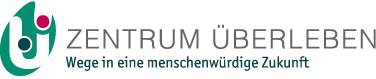Jahresbericht 2023/2024
Gemeinsam Herausforderungen meistern
Berufsalltag einer Traumatherapeutin
10.7.2025
Was erwartet Mitarbeitende, die neu im ZÜ starten? Wie sehen häufig ihre Erwartungen aus – wie gestaltet sich der Joballtag in der Realität? Sarah R. arbeitet seit dem Jahr 2023 als Ärztin in Weiterbildung in unserer Ambulanz für Erwachsene und gibt uns Einblicke in ihren Arbeitsalltag und wie sie den Start ins ZÜ empfunden hat.
Einer der Gründe, warum Sarah R. Teil des Teams im Zentrum ÜBERLEBEN wurde, war ihr Interesse an der psychotherapeutischen Arbeit mit dem Fokus auf Traumatherapie. Sie hatte zuvor in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet und war nun gespannt auf die ambulante Tätigkeit im ZÜ, in der sie Menschen aus verschiedensten Ländern dabei helfen kann, traumatisierende Erlebnisse aufzuarbeiten.
„Meine ersten Tage hier bestanden natürlich, wie bei jedem neuen Arbeitsplatz, viel daraus, alles kennenzulernen. Schon zu Beginn der Tätigkeit war es auch nötig, sich mit asylrechtlichen Fragen und den Besonderheiten der Arbeit in einer NGO auseinanderzusetzen. Mittlerweile bin ich in meinem Arbeitsalltag angekommen. Dieser besteht vorrangig aus der psychotherapeutischen Arbeit. Manche Patient:innen erhalten zusätzlich unterstützend eine psychiatrische Behandlung. Hier geht es vor allem darum, eine psychiatrische Einschätzung vorzunehmen und ggf. eine Medikation einzuleiten. Im Team werden darüber hinaus abwechselnd die Telefonsprechstunde und die Erstgespräche abgedeckt. Ein niedrigschwelliger Zugang ist uns wichtig damit jeder Mensch, der Interesse an einem Therapieplatz hat, bei uns anrufen kann. Wir überprüfen dann in den Erstgesprächen, ob die anfragende Person für einen Behandlungsplatz infrage kommt. In unseren wöchentlichen Teamsitzungen und regelmäßigen Supervisionen tauschen wir uns zudem auch untereinander ausführlich über unsere Patient:innen aus.“
Erwartungen vs. Realität – wie sieht das nach dem Start in der Ambulanz aus? Verlaufen die Arbeits- und Therapieprozesse so, wie man es sich vorher vorgestellt hat oder gibt es auch unerwartete Aspekte?
„Meine Vorstellung von Traumatherapie spiegelte das allgemeingültige Vorgehen, wie es in Büchern und Leitfäden beschrieben ist, wider. Das Spezielle an der Therapie ist insbesondere der dosierte Wechsel zwischen Traumainhalten, zum Beispiel bei einer Konfrontation, und Stabilisierung. Vergleichbar mit einem Pendel, das an der für Patient:innen bewältigbaren emotionalen Belastungsgrenze schwingt. Bei unseren Klient:innen ist eine Umsetzung dieses Konzeptes aber nochmal komplexer, weil Stabilität und Sicherheit in der persönlichen Lebenssituation geflüchteter Menschen oft nicht gegeben sind. Ohne die sichere Basis kann man sich nur erschwert an das Trauma heranwagen.“
Ein langfristig gesicherter Aufenthaltsstatus, eine ruhige Wohnung als Rückzugsort, die Familienangehörigen in Sicherheit – all das sind Grundbedingungen, die bei den meisten unserer Patient:innen nicht gegeben sind.
„Da die Lebensrealität für geflüchtete Menschen in Deutschland häufig wenig Sicherheit bietet, muss man die Therapie hier entsprechend anpassen. Es gibt einfach viele existenzielle Krisen, die ebenfalls abgefangen werden müssen. Fragen, die wir uns täglich beantworten müssen, sind beispielsweise: Wie kann man mit einem Menschen arbeiten, der eine Traumatherapie braucht, um wieder in einer persönlichen Normalität anzukommen, wenn er nach den Sitzungen in eine Gemeinschaftsunterkunft zurück muss, wo es nicht mal einen privaten Raum der Sicherheit und Geborgenheit gibt? Oder wie kann ich einen Therapieprozess planen, wenn gleichzeitig unklar ist, welche langfristige Aufenthaltsperspektive besteht? Das alles sind Aspekte, die wir berücksichtigen müssen und unsere Arbeit verkomplizieren.“
Im Ambulanz-Team arbeiten mitunter aus diesem Grund Therapeut:innen und Sozialarbeiter:innen eng zusammen. Alle Patient:innen bekommen sozusagen ein kleines Betreuungsteam zugeordnet, bestehend aus therapeutischer und sozialarbeiterischer Fachkraft. Außerdem natürlich auch eine:n Sprach- und Kulturmittler:in, welche:r die Kommunikation in der Muttersprache ermöglicht.
„Viele Dinge, die den Patient:innen zu Beginn der Therapie auf dem Herzen liegen, sind sozialarbeiterische Anliegen. Die Hauptthemen sind gerade am Anfang der Behandlung häufig die Wohnsituation, Behördengänge, aufenthaltsrechtliche Fragen etc. Ohne unsere Sozialarbeitenden würde auch bei mir als Therapeutin vermutlich eine große Ohnmacht einsetzen. Wenn es nur in den Therapiesitzungen den Raum gäbe, um Probleme des täglichen Lebens zu klären, könnte man gar nicht dazu kommen, sich dem eigentlichen Trauma anzunähern. Deswegen ist die enge Abstimmung im Behandlungsteam so wichtig und stellt sicher, dass die Nöte der Patient:innen ganzheitlich bewältigt werden.“
.

Die Arbeit der ambulanten Abteilung für Erwachsene wird u.a. finanziert durch das Projekt Stepped Care 2.0. Das Projekt ‚Stepped Care 2.0 – Weiterentwicklung eines stufenweisen Behandlungskonzepts für besonders Schutzbedürftige‘ wird kofinanziert von der Europäischen Union mit Mitteln aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF).
> Mehr Informationen zur ambulanten Abteilung für Erwachsene
> Alle Jahresberichte des Zentrum ÜBERLEBEN im Überblick
* Titelbild: Symbobild/Foto anonymisiert
.