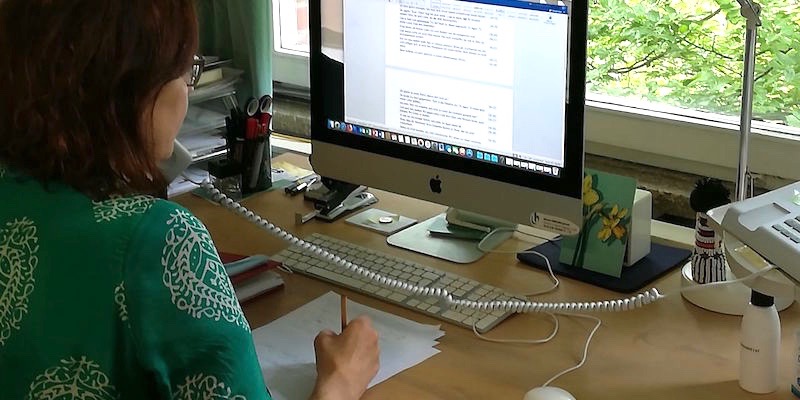Die Erwachsenen-Ambulanz in der Corona-Krise
Neue Herausforderung:
Psychotherapie per Telefon
19.5.2020
Die Corona-Krise hat die Arbeit in unserer Erwachsenen-Ambulanz komplett umstrukturiert. Therapien laufen über Telefon und wenn es möglich ist, vereinzelt über Videokonferenzen. Für die dringenden ambulanten Fälle sind unsere Kolleg*innen vor Ort. Assistenzärztin und Psychotherapeutin Manuela Steigemann (in Ausbildung) und psychologische Psychotherapeutin Nicola Klambt (in Ausbildung) berichten von ihren Erfahrungen in dieser Krise.
Lässt sich Psychotherapie denn übers Telefon weiterführen?
Manuela Steigemann: Das habe ich mich auch gefragt und war skeptisch, ob das geht. Die Patient*innen sind jedenfalls alle pünktlich beim Telefontermin. Bei einigen ist es so wie immer, aber bei einigen erlebe ich, dass mehr Ruhe und Struktur hineinkommt, weil noch mehr darauf geachtet werden muss, wer wann spricht.
Ich selbst bin in der guten Lage, dass ich alle Patient*innen lange genug kenne und mir der Wechsel somit gut gelungen ist. Da ich mir in der vorangegangenen direkten Psychotherapie ein gutes Bild über die Patient*innen mit allen Aspekten wie Symptomen, Lebensgeschichte, Traumata, aber auch der Psychodynamik machen konnte, habe ich weniger Probleme, die Psychotherapie per Telefon fortzusetzen. Anders ist es bei einem Erstkontakt per Telefon. Hier ist es erschwert bzw. nicht möglich, eine Anamnese, besonders eine Traumaanamnese zu erheben. Es ist auch sehr schwer, einen Zugang zur Psychodynamik zu bekommen, da bestimmte Aspekte wie das Verhalten und das Gesamtbild des Patienten oder der Patientin als auch interaktionelle Vorgänge fehlen. Insgesamt bin ich dankbar, dass wir aktuell so arbeiten können, vermisse es aber sehr, meine Patient*innen zu sehen. Insofern hoffe ich, dass wir bald wieder den face-to-face-Kontakt erleben.
Nicola Klambt: Der Kontakt bei der telefonischen Therapie ist ganz anders und ich muss viel mehr nachfragen, weil ich ja die ganze szenische Information nicht habe. Die Patient*innen sind dagegen gezwungen, ihre Gefühle in Worten zu beschreiben, die ich ihnen sonst auch ansehen kann.
Außerdem ist es schwer für die Patient*innen, einen ruhigen Ort zu finden. Für eine Videokonferenz hapert es manchmal an der digitalen Struktur, weil der Laptop gerade von den Kindern besetzt ist, die etwas für die Schule machen müssen oder kein stabiles WLAN vorhanden ist. Die Patient*innen telefonieren von der Toilette oder in der Gemeinschaftsküche, was eigentlich untragbar ist. Traumatherapie ist in dem Sinne nicht möglich. Man kann niemanden konfrontieren, bei dem man nicht weiß, wie stabil die Lebenssituation gerade ist.
Umgekehrt ist es gerade jetzt ungemein wichtig, den Kontakt zu halten – auch zur Prävention häuslicher Gewalt. Die ganze Familie hockt in einem Raum, es gibt kaum Zeit für einen selbst und „Dichte-Konflikte“ nehmen zu. Um hier zu helfen, ist die Telefon- oder auch Videotherapie gerade jetzt unfassbar wichtig.
Manuela Steigemann: Kompliziert wird es mit dem Telefonieren, wenn eine Familie in nur einem Zimmer wohnt und der Patient keinen Ort hat, an dem er in Ruhe telefonieren kann. In den Unterkünften ist es unruhig und laut. Ich nehme das als Geräuschkulisse wahr und erlebe diese Lautstärke erstmals live, wovon die Patient*innen mir häufig berichten und worunter sie leiden. Es ist in den Zimmern sogar bei geschlossenen Türen noch laut.
Haben sich bei Patient*innen durch die Krise auch Symptomatiken verstärkt?
Manuela Steigemann: Teilweise gab es eine Zunahme der bestehenden Symptomatik, also eine Verschlechterung des psychischen Befindens. Es kam bei Patient*innen beispielsweise auch zur Zunahme von depressiven Symptomen.
Nicola Klambt: Ich habe einen Patienten, der gerade in eine Wahnsymptomatik abrutscht, die es vorher schon einmal gegeben hat, aber die eigentlich am Abklingen war. Ich denke, dass sie durch die Überflutung von Ängsten verursacht wird, weil er nicht weiß, wie es seiner Familie in Syrien ergehen wird mit dem Corona-Virus.
Welche Bedeutung hat das Zentrum ÜBERLEBEN für Eure Patient*innen?
Nicola Klambt: Dass dieser eben erwähnte Patient nicht mehr hierher kann, bringt ihn mit tiefen Ängsten in Kontakt, dass auch wir als Behandlungszentrum wieder verschwinden könnten. Das führt zu einer Aktivierung von Verlustängsten.
Wir arbeiten ja mit schwer traumatisierten Menschen, die schon einmal alles verloren haben, alle ihre Bindungen oder die nie Bindungen aufbauen konnten. Für sie ist das Zentrum ÜBERLEBEN wie ein sicherer Hafen und sie haben ja hier ein vielfältiges Programm: sie gehen zur Berufsberatung, sind in der Kreativgruppe, in der Gartengruppe ab Frühjahr, kommen zu mir in die Therapie, haben einen Termin bei der Psychiaterin, bei den Sozialarbeiter*innen oder bei der Diagnostik unserer psychologischen Praktikant*innen. Hier ist also schon Einiges los.
Wenn so eine Struktur von heute auf morgen wegfällt oder es uns nur noch als Stimme am Telefon gibt, dann ist das für einige Patient*innen sehr beängstigend. Viele meiner Patient*innen schlafen jetzt schon bis in den Mittag hinein. Das führt dann wieder zu Schlafstörungen nachts…
Wie erarbeitet Ihr eine alternative Tagesstruktur bei all den Einschränkungen?
Nicola Klambt: Die Patient*innen müssen sich jeden Tag eine kleine Sache aufschreiben, auch Aufgaben erledigen, draußen spazieren gehen. Ich bin jetzt mehr mit Alltagstipps am Start und beantworte Fragen: wo lässt sich ein gebrauchtes Fahrrad oder ein gebrauchtes Notebook kaufen und wo liegen Parks in der Nähe. Die Patient*innen sollen uns dann digital Fotos zeigen, wo sie waren und was sie entdeckt haben – mit der Familie und in der Natur. Auch wenn sie meine Vorschläge zunächst nicht attraktiv finden, machen sie, was ich sage. Meistens ist es eine gute Erfahrung, ihre Kinder haben ein bisschen mehr Bewegung bekommen und sind abends müder. Wir unterstützen unsere Patient*innen aktuell auch bei ihren Arztbesuchen, die üblicherweise von unseren Dolmetschenden vor Ort begleitet werden. Die Dolmetschenden sind zwar nicht vor Ort, dafür aber am Handy für die weitere Koordinierung dabei.
Alles in allem glaube ich, dass wir eine ganz wichtige Infrastruktur für die Patient*innen sind. Denn wenn Du in einer Krise bist, wendest Du Dich dahin, wo Du den Leuten vertraust.
> Anmeldung zum E-Mail-Newsletter
Foto: Zentrum ÜBERLEBEN